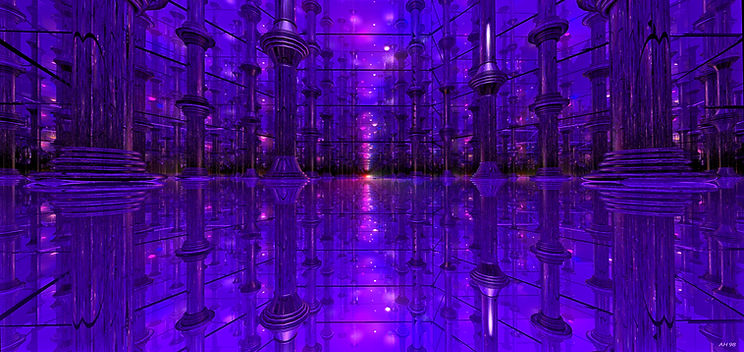Kythings
Episodes
Gedankenexperimente
Zur Verteidigung des IDEALS
Eine Ouranian Chronicles Meditation
Kything 001
Liegen unsere besten Tage hinter uns oder haben wir sie noch vor uns?
Philosophen nahmen ihre Stellung dazu auf beiden Seiten dieser Frage ein. Die Pythagoräer träumten von einer goldenen Vergangenheit, einer Zeit, in der die Götter den Kosmos in vollkommener Weisheit beherrschten und wir unter ihnen Arm in Arm über die Milchstraße schlenderten. Andere, wie Aristoteles, glaubten, dass die Vollkommenheit in der fernen Zukunft zu suchen sei. Und zwar so weit weg, dass sie das Ende der Zeit markiert, und dass Sterbliche wie wir—gefangen zwischen einer verschwommenen Vergangenheit und der glänzendsten aller Zukünfte—uns mit jeder Faser unseres Seins danach sehnen, sich mit dem zu vereinen, was vor uns liegt, und sei es nur, um zu dem zu werden, was wir sein sollen.
In zahlreichen Büchern wurde darüber gestritten, wo der Ort des Ideals liegt, und wo oder wann es verwirklicht wird. Denn in der Gegenwart ist es sicherlich nicht zu finden. Nicht, wenn wir uns den Zustand der Welt vor Augen halten. Vielleicht „wohnt” das Ideal jenseits von Zeit und Raum, abgeschottet hinter einer Himmelspforte oder in der Ungreifbarkeit des Nirwana? Oder sollen wir einer neuen Generation von „Aposteln” Glauben schenken, die behaupten, dass es so etwas wie das Ideal nicht gibt? Unter dem Deckmantel der Wissenschaft bezeichnen sie solche Begriffe als Wahnvorstellungen, Unsinn und Selbstbetrug. „Einen solchen Zustand hat es nie gegeben und wird es auch nie geben. Entstanden aus dem Chaos werden wir im Chaos enden; unsere vermeintliche Existenz sei nichts weiter als ein Tropfen in einem Meer der Entropie und Verwirrung.” Das behaupten sie jedenfalls.
Doch die meisten von uns befinden sich irgendwo in der Mitte zwischen all diesen Möchtegern-Advokaten der Gewissheit. Wir sehnen uns immer noch nach dem Ideal, so schwer es auch manchmal sein mag, es zu erträumen. Wir wissen, dass es irgendwie da ist, gar nicht mal so weit weg und durchaus erreichbar. Wir würden es nicht wagen, Kinder in die Welt zu setzen, wenn wir etwas anderes glaubten. Unsere Vorstellung vom Ideal erlaubt es uns, Anforderungen zu formulieren, und Maßstäbe für Fortschritt und Verbesserung zu setzen anhand deren wir messen können, wie weit wir es noch haben zum Ziel. Kein Plan kann ohne die Vorstellung eines Ideals konzipiert werden. Ohne ein solches Ideal hätte das Wort „sollte” keine Bedeutung—ebenso wenig Begriffe wie „gut”, „gesund”, „vorzüglich”, „schön”, „ausgezeichnet” und „genau richtig”. Wir würden so viel verlieren, wenn wir die Vorstellung vom Ideal verlieren, nicht nur wer wir sind, sondern auch wer wir anstreben zu sein.
Wer spricht dann in unserem Namen? Wer spricht für diejenigen, die das Streben nach Exzellenz und Vervollkommnung nicht aufgegeben haben und es in allem, was sie tun, weiterhin anstreben? Manche von uns verbinden das Ideal mit einem Gefühl von Spiritualität und moralischer Richtschnur. Was ist das Gewissen, wenn nicht ein inneres GPS, das uns auf dem rechten Weg hält?
Ich frage noch einmal: Wer spricht für den Rest von uns? Für die Künstlerinnen und Künstler, die fähig sind das Ideal zu erfassen, es zu pflegen und zu vervollkommnen, bis es für alle sichtbar wird? Oder für die Friedensstifter, die sich gegen Krieg, Leid und Zerstörung stellen? Oder für die Heilerinnen und Heiler, die versuchen, alles Leid zu lindern, oder zu beheben? Oder für die Entdecker, die auf der Suche nach einem besseren Ort immer über den nächsten Hügel, Berg, Ozean oder sogar Planeten hinausschauen? Und es gibt noch weitaus mehr von uns, die es wagen von einer besseren Welt zu träumen.
Als Träumer können wir es uns nicht leisten so überheblich zu sein, die Möglichkeit eines Ideals zu leugnen.
Manche von uns erachten es sogar in gewisser Weise als übersinnlich. Wie sonst könnten wir die Verbindung erklären, die wir gelegentlich mit etwas empfinden, das größer oder dauerhafter erscheint als unsere sterbliche Hülle? Die meisten von uns wagen es nicht, ihren Anteil an der Weisheit für so unanfechtbar zu halten wie die vorherrschende Flut von Atheisten auf YouTube, die ihren Unglauben mit selbstgerechtem Eifer propagieren, der einen Fernsehprediger erröten ließe. Doch viele von uns tröstet das Bild eines weißbärtigen Mannes im Himmel auch nicht, dessen Wege für uns genauso undurchschaubar geworden sind wie die unsrigen für ihn. Das Ideal ist nicht unergründbar, und es würde uns auch nicht im Stich lassen. Weshalb sind wir denn sonst auf dieser Welt, wenn nicht, um es zu verwirklichen?
Aus diesem Grund schlägt die Serie der Ouranian Chronicles (kurz OC) einen dritten, wenn auch vergessenen Weg vor—einen, der weit abseits liegt von den ausgetretenen Pfaden, die von Eiferern, egal welcher Schattierung oder Überzeugung, frequentiert werden. Dieser in Vergessenheit geratene Pfad lässt eine Idee wieder aufleben, die die antreibende Kraft sein könnte, Extrempositionen zu überwinden oder ihnen zumindest den Stachel zu nehmen.
Was ist, wenn es Ursachen gibt, die sich der Physikalität entziehen, ich meine der Körperlichkeit, wie wir sie heute definieren? Intelligenzen, die sich nicht in unsere Naturgesetze einmischen, die uns aber dennoch auf ungeahnte Weise zu beeinflussen vermögen? Vielleicht mit Hilfe unseres Gewissens? Oder durch unsere Vorstellungskraft? Unserer Sehnsucht nach einer besseren Welt? Was wäre, wenn unsere edleren Impulse von rationalen Wesen ausgingen, die uns aus dem Ideal heraus ansprechen—musenähnliche Wesen—die wissen, wie wir früher dorthin gelangen könnten? Weil sie vielleicht den gleichen prekären Weg gegangen sind wie wir, ohne sich dabei in die Luft zu sprengen?
Dementsprechend benötigt das OC kein Pantheon allmächtiger Götter, um unsere Existenz zu erklären, oder weshalb wir hier sind. Aber es versucht auch nicht, „übersinnliches“ Eingreifen als Selbsttäuschung abzutun und alle Kausalität der Teilchentheorie, dem Zufall, und Vakuumfluktuationen zuzuschreiben.
Stattdessen wird ein anderes Gedankenexperiment vorgeschlagen: Was, wenn die „Götter“wir sind? Wir, aber im Ideal? In der Form unserer besseren, nein, unserer besten Version des Selbst? Lass deiner Fantasie freien Lauf: Wie sähe die beste Version deines Selbst von dir aus? Und würde das Streben nach diesem Ideal-Ich dein Leben, wie du es kennst, verändern?
Einer der spannenden Aspekte dieser Art von Gedankenspiel ist die Möglichkeit, das Geistige mit dem Materiellen zu versöhnen. Gibt es denn einen besseren Kandidaten für den sogenannten „Gott aus der Maschine“ als wir?
Ist die Evolution nicht ein Prozess, der vorhersehbar von der Einfachheit zur Komplexität voranschreitet, was wir mit Fortschritt gleichsetzen? Was wäre, wenn der Verlauf unserer Entwicklung—vor allem, wenn wir lernen, unsere Verbesserung zu steuern—uns immer näher an einen idealen Zustand heranführt? Einem Idealzustand, der von uns nach unseren höchsten Normen und Maßstäben entworfen wurde. Wer kann dann noch behaupten, dass diejenigen unter uns, die es bis zum Idealzustand schaffen (sagen wir eine Zivilisation vom Typ II-III auf der Kardaschew-Skala*), nicht nach Wegen suchen würden, ihren Vorgängern die Hand zu reichen, um sie in die richtige Richtung zu lenken—und sei es nur, um die Qualen des Fortschritts zu lindern oder um Sackgassen-Zivilisationen und andere soziale cul-de-sacs zu vermeiden?
Kurz gesagt, was wäre, wenn wir unseren „Göttern” bereits begegnet sind, und sie sind wir? Wir—im Ideal?
Ja, das ist eines der Themen, mit denen sich die Ouranian Chronicles Serie befasst. So viel kann ich einräumen.
Seid versichert, dass das Werk trotz der vermeintlich erhabenen philosophischen Themen im Kern ein historischer Abenteuerroman ist. Das kann ich versprechen. Er lehnt sich auch stark an das Format des Kriminalromans und an spekulative Fiktion an. Die Handlung konzentriert sich jedoch fast ausschließlich auf die Charaktere. Dies bis hin zu dem Punkt, dass man das Werk als „epische Liebesgeschichte in drei Akten” bezeichnen könnte—wie es eine meiner Lektorinnen ausdrückte. Ich persönlich überlasse solche Urteile gerne dem Leser.